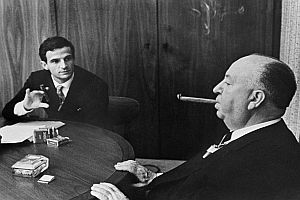Achtung unterschwellige Filmkalauer: Rob Bottin ist ein
außergewöhnlicher, ein auf seinem Gebiet singulärer Maskendesigner, und
wenn Regisseure auf Rob Bottin vertrauen, damit er in ihren Filmen
bizarr aus sich heraus wuchernden Schrecken verbreiten soll, dann kommen
die Schocks zumeist aus einer anderen Welt, sehen heute aber noch
frisch so aus, als wäre es erst gestern gewesen und wir könnten uns
total daran erinnern. Zum Beispiel in John Carpenters dichter
Ansteckungsangst "Das Ding aus einer anderen Welt", auf dessen DVD
Bottin ruhigen Gewissens verkündet hätte: Hey, seht mal her, das ist
Hollywood, das bin ich, seht, was wir drauf haben. Ihr könnt das nicht,
ich schon. Aber Bottin könnte es sich leisten, dies so offensiv zu
formulieren. Denn er ist bar jedweden Zweifels ein Spezialist in seinem
Metier, ein Meister, ein vollständiger Virtuose, der auf der Klaviatur
der abnormen Körperlichkeit die schleimigsten Tasten betätigt. Jeder,
der Carpenters Remake zum ersten Mal sieht oder als Zeitzeuge in den
frühen Achtzigern im Kino gar gesehen hat (und sich mehr über die
Reaktionen des Publikums gruselte), sah etwas, was er noch nie zuvor
gesehen hat.
Man kann nicht glauben, wie die das gemacht haben, der in
die Höhe schnellende Kopf mit den Spinnenbeinen etwa, die beiden Männer
zu einer obszönen Spukgestalt Kopf an Kopf vereint, die Absorbierung des
Hundes zu einem fleischigen Tentakelwesen. Auch in "Total Recall",
"RoboCop" und "Sieben" tobt sich
Bottin im freien künstlerischen Selbstbewusstsein aus, diesen Filmen
ihre ungezügelte Wildheit, ihre rohe Brutalität und ihren freien
biochemischen Umgang mit der dunkleren Seite der menschlichen Evolution
einzudrücken. Transformationen, Assimilationen und Mutationen sind
Auswüchse einer grotesken organischen Geisterbahnfahrt, so glitschig, so
pervers, so ekelerregend, dass man sich danach gar nicht mehr zur
Toilette traut, in der Angst, es käme etwas von unten hochgeschossen.
Bottin ist auch deshalb genial, weil er die Vergänglichkeit von CGI
offenlegt, während seine Modelle unsterblich bleiben. Unsterblich
anders.
Ein erfolgreicher Wiederbelebungsversuch der Kreatur im Bauch
"Das Ding aus einer anderen Welt"
"The Thing"
(USA 1982 | John Carpenter)
Nebenwirkung: Grüne Kopfkontraktionen
Neben-Nebenwirkung: Mensch-Mensch-Absorbierung
Der Sehnerv außerhalb des Sichtfeldes
"Die Reise ins Ich"
"Innerspace"
(USA 1987 | Joe Dante)
Kubrick-Poesie im menschlichen Körper
Bring' deine Magensäure zum Kochen!
Nie war ein Arzt notwendiger...
"RoboCop"
(USA 1987 | Paul Verhoeven)
Futuristisch; gleichzeitig elektronisch, menschlich und real
Der Säuremann ergibt sich seinem Schicksal
Auf dem Mars ist es ungemütlicher als auf der Erde
"Die totale Erinnerung - Total Recall"
"Total Recall"
(USA 1990 | Paul Verhoeven)
Körper im Körper aus Körpern
Welche nehme ich?
Trägheit
"Sieben"
"Se7en"
(USA 1995 | David Fincher)
Ja nicht dem Schmerz verschließen, hörst du!
"Fight Club"
(USA, D 1999 | David Fincher)
Blut Fight